-
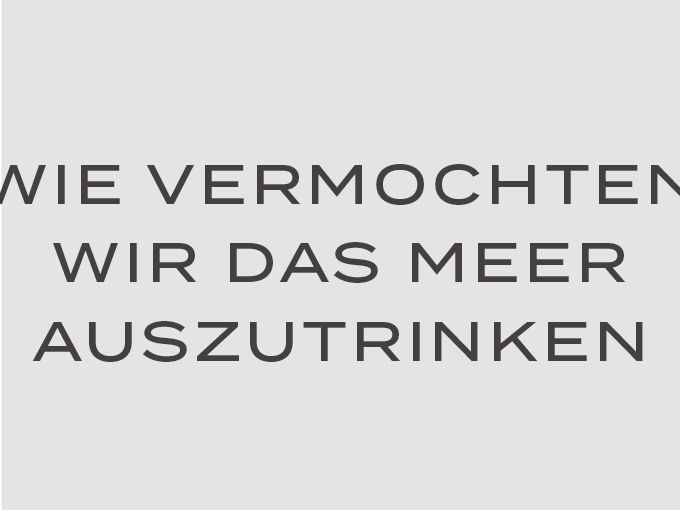
-

Arianna Fantin, testo cucito, 2011
Foto: Arianna Fantin -

Christian Murzek, Zellularer Automat - Regel 5, 2017
Foto: Christian Murzek -

Georg Oberhumer, Beistrich, 2016
Foto: Markus Krottendorfer -

Julia Haugeneder, o.T. (bed), 2017
Foto: Julia Haugeneder -

Natalie Neumeier, notizen zu lys/licht, 2016
Foto: Leni Deinhardstein -
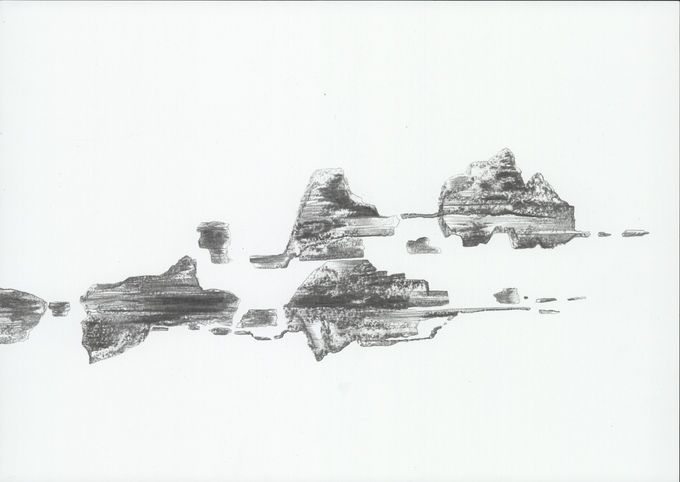
Sabine Priglinger, toxic residuals (IV), 2017
Foto: Sabine Priglinger -

Wie vermochten wir das Meer auszutrinken, Ausstellungsansicht
Foto: 5020/Rauchenbichler -
Julia Haugeneder, o.T. (gerezen wit), 2017, Detail
Foto: 5020/Rauchenbichler -
Wie vermochten wir das Meer auszutrinken, Ausstellungsansicht
Foto: 5020/Rauchenbichler -
Wie vermochten wir das Meer auszutrinken, Ausstellungsansicht
Foto: 5020/Rauchenbichler -
Natalie Neumaier, (notizen zu lys/licht), 2016
Foto: 5020/Rauchenbichler -

Arianna Fantin, Testo cucito, 2011
Foto: 5020/Rauchenbichler -
Wie vermochten wir das Meer auszutrinken, Ausstellungsansicht
Foto: 5020/Rauchenbichler -
Natalie Neumaier, (notizen zu lys/licht), 2016/2017, Detail
Foto: 5020/Rauchenbichler -
Julia Haugeneder, o.T. (der Abstand wird kleiner VIII), 2017
Foto: 5020/Rauchenbichler
Wie vermochten wir das Meer auszutrinken
Arianna Fantin/ Julia Haugeneder/ Christian Murzek/ Natalie Neumaier/ Georg Oberhumer/ Sabine Priglinger
Eröffnung: Freitag, 10.11.2017, 19 Uhr
Vortrag von Hans-Joachim Lenger: Freitag, 10.11.2017, 17h
Die Idee zur Ausstellung Wie vermochten wir das Meer auszutrinken entstand in Auseinandersetzung mit dem Begriff des „Gemeinsam-seins“. Diesem haftet sowohl in der Kunst als auch in gesellschaftspolitischen Ordnungen ein hoffnungsvoller Gedanke an: die Möglichkeit, Gemeinschaften herstellen zu können, in denen es sich gemeinsam aushalten lässt.
Unbestritten ist, dass sich das Problem des „Gemeinsam-seins” stets aufs Neue stellt und dies gerade jetzt – in Zeiten der Aufrüttlung „europäischer Homogenität“ durch außereuropäische Einflüsse – mit besonderer Dringlichkeit. Ein „Gemeinsam-sein“ kann jedoch in keinem Fall auf einem Gegebenen des gemeinsamen Seins beruhen. Vielmehr stehen wir vor der Aufgabe, ein „Gemeinsam-sein“ zu denken, das als Sein jenseits von Identitäten, Zuständen und Subjekten situiert ist.
Jean Luc Nancy, der seit vielen Jahren in zahlreichen seiner Texte über ein „Gemeinsam-sein“ nachdenkt, erläutert die Notwendigkeit eines neuen Begriffs des „Gemeinsam-seins“ sehr plastisch mit der Säkularisierung unserer Lebenswelt. „Die Gemeinschaft […] der Menschen hatte sich sich selbst ausgeliefert, indem sie sich von religiösen Bindungen, die ihr im Übrigen ihre [...] Konsistenz verliehen hatte, entband und sich eine Geschichte der – notwendigerweise gemeinsamen […] – Selbsthervorbringung der Menschen eröffnete, sowohl als Gattung als auch als Einzelnen.“1 Diese Geschichte der Selbsthervorbringung des Menschen beginnt mit dem, was Nietzsche den Tod Gottes nennt. „Wie vermochten wir das Meer auszutrinken?“2, lässt Nietzsche in „Die fröhliche Wissenschaft“ den „tollen Menschen“ fragen. Dieses Meer ist Gott als Bezugssystem des Menschen, das Koordinatensystem innerhalb dessen sich der Mensch zu verorten wusste und das ihm Konsistenz verlieh. Dass der Mensch sich diesem selbst enthoben hat, war der Grundstein für Georg Lukacs’s „transzendentale Obdachlosigkeit“ – einen Begriff, der auch heute noch unser Denken prägt. Der „tolle Mensch“ weiß, dass die Auflösung Gottes ein für das menschliche Denken undenkbares Ereignis darstellt. Er spricht daher weiter: „Diese That ist ihnen immer noch ferner, als die fernsten Gestirne, – und doch haben sie dieselbe gethan!“3 Diese Tat ist uns heute noch kaum näher. Es ist der Mensch selbst, der sich von Gott befreit und sich damit aber gleichzeitig in die Leere begibt, in der es keine Konstanten, keine Anhaltspunkte mehr gibt. „Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen?“4, so lautet die zweite Frage des „tollen Menschen“ bei Nietzsche.
Kein Horizont ist gleichbedeutend mit einem „Horizont des Unendlichen“5, den Nietzsche mit dem offenen Meer in Verbindung setzt. Nancy antwortet scheinbar auf Nietzsche, wenn er von diesem Horizont des Unendlichen schreibt: „keine Linie mehr, die gezogen wurde, noch eine, die sich ziehen ließe, um daran die Marschroute auszurichten oder einen Hinweis für den Kurs zu erhalten.“6
„Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Giebt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an?“7
Inmitten dieses leeren Raums findet also diese Selbsthervorbringung des Menschen statt, was ganz schlicht so viel bedeutet wie: wir sind. Und die Einsicht, dass wir nur gemeinsam sind, ist so trivial wie schwerwiegend. Denn der bloße „Rückgriff auf kommunitäre Wesenheiten“8 als Bestimmungsmerkmal einer Gemeinschaft hat in den vergangenen Jahrhunderten zu Massakern und der Verordnung des Todes geführt.9
Das „Gemeinsam-sein“ kann, soviel ist durch die jüngere Geschichte klar geworden, unter keinen Umständen auf Filiation, Ursprung, Erwählung oder mystischer Identität basieren.10 Wie also, fragt Nancy, „wie also gemeinsam sein, ohne das zu bilden, was die gesamte Tradition [...] eine Gemeinschaft nennt (einen identitären Körper, eine Intensität des Eigenen, eine natürliche Intimität)?” Und er antwortet: „Zusammen-sein“, doch „zusammen- sein“ zu aller erst verstanden als Bedingung und nicht als ein vom Sein losgelöster Wert. Nancy’s Wort dafür ist das lateinische „cum“, im Deutschen „mit“, aber besser bestimmt mit dem französischen „d’avec“ (von-mit). „Cum“ bezeichnet die Koexistenz der Seienden in der Welt, es setzt „uns einander gegenüber, es liefert uns einander aus, es bringt uns gegeneinander in Gefahr, und es liefert uns alle zusammen nichts anderem aus als der Erfahrung dessen, was es ist – [...] aber ‘es selbst’ ist unendlich und ohne Identität.“11 Wesentlich dabei ist, dieses „zusammen-sein“ keinesfalls zu glorifizieren. Dieses „mit“ findet nicht zwischen Subjekten statt, sondern ist Ort und Bedingung dafür, dass etwas stattfinden kann, wir uns begegnen können. Das „Gemeinsam-sein“ ist damit ein „mit-sein“, nicht an einem lokalisierbaren Ort, sondern in einem offenen „cum“.
Wir stimmen Nancy zu, wenn er eindringlich darauf hinweist, dass ein „offenes cum“ nicht schon einen Wert für sich generiert, sondern nur, das heißt vor allem, „die Bedingung der Koexistenz endlicher Singularitäten“ ist, „zwischen denen die Möglichkeit von Sinn endlos zirkuliert.“12
Was uns dazu bewegte, eine Ausstellung rund um einen Begriff zu initiieren, der sich jeder Exposition in kristalliner Form entzieht, ist die Überzeugung, dass für Denken immer eine Anrede nötig ist – Dasein, das „Gemeinsam-sein“ bedeutet, heißt auch, dass sich Denken nicht solitär, sondern unter der Bedingung des gegenseitigen „Ausgesetzt-seins“ vollzieht.
Die in der Ausstellung gezeigten Werke der sechs Künstlerinnen und Künstler sind zum Großteil im vergangenen Jahr entstanden – dennoch wäre es nicht richtig zu sagen, die Arbeiten wären „für die Ausstellung“ produziert worden; ja nicht einmal beschäftigen sie sich direkt mit dem Thema des Gemeinsam-seins. Der Grund dafür liegt vor allem in der schlichten Tatsache, dass der von uns hier skizzierte Themenkomplex nicht mit Blick auf ein Resultat „erarbeitet“ werden kann. Ein „Gemeinsam-sein“ entsteht jedoch im „Zwischen“ – zwischen uns, in den Gesprächen des letzten Jahres als Vorbereitung auf die Ausstellung, zwischen den ausgewählten Arbeiten, zwischen den beteiligten Akteurinnen und Akteuren, im „Zwischen“ jeder einzelnen Arbeit und natürlich auch in jenem „Zwischen“, das durch ein Ausstellen und Öffentlich-machen realisiert wird. Es wäre daher gelogen, dass die Ausstellung sich mit dem Gemeinsam-sein „beschäftigt“, vielmehr ist sie dessen Artikulation, die in der Fünfzigzwanzig ihre vorläufige Form findet.
Hier soll also kein Diskurs entworfen werden, hingegen teilen wir, was Jean-Luc Nancy hoffnungsvoll als Erwartung an seine Arbeit formuliert: „dass die Anrede wahrnehmbar wird von einem Denken, das uns von überall her erreicht, simultan, vielfach, wiederholt, insistierend und variabel, und dabei niemand andrem ein Zeichen gibt als „uns“ und unserem neugierigen ‚Mit-ein-ander-sein’, die-einen-die-anderen-anredend.“13
(Text: Julia Haugeneder und Sabine Priglinger)
1 Nancy, Jean-Luc, Das nackte Denken, aus dem Franz. von Markus Sedlaczek, Zürich-Berlin: Diaphanes 2014, S. 141
2 Friedrich Nietzsche: Werke in drei Banden. München 1954, Band 2, S. 126
3 ebd.
4. ebd., S. 127
5 ebd.
6 Nancy, Jean-Luc, Singulär plural sein, aus dem Franz. von Ulrich Müller-Schöll, Zürich: Diaphanes 2004, S. S. 9f.
7 Friedrich Nietzsche: Werke in drei Banden. München 1954, Band 2, S. 127
8 Nancy, Das nackte Denken 2014, S. 142
9 vgl. ebd., S. 141 f.
10 vgl. ebd. S. 142
11 ebd., S. 146
12 ebd., S. 149
13. Nancy, Singulär plural sein, S. 14
Julia Haugeneder (*1987) ist Doktorandin an den Instituten Theater-, Film- und Medienwissenschaften und Kunstgeschichte (Universität Wien) und studiert an der Akademie der bildenden Künste Wien, Klasse für Grafik und druckgrafische Techniken. Sie forscht zum Begriff des Neutralen bei Maurice Blanchot und dem druckgrafischen Werk Mira Schendels.
Sabine Priglinger (*1984) ist Doktorandin am Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften an der Akademie der bildenden Künste Wien und arbeitet im Ausstellungsmanagement in der Kunsthalle Exnergasse / WUK. In ihrer Forschung fokussiert sie das Thema der Zeitmessung als Strategie und Praxis zeitgenössischer Kunst unter Einbeziehung differenzphilosophischer Theorien sowie Performance Studies.
Hans-Joachim Lenger (*1952 ) ist Professor für Philosophie und Medientheorie an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Er veröffentlicht regelmäßig philosophische, kunst- und medientheoretische Beiträge in Zeitschriften, Sammelbänden und Katalogen und ist Autor einer Vielzahl von Rundfunkbeiträgen für verschiedene Sender der Bundesrepublik. Seine politischen und philosophischen Fragen gelten insbesondere der Kunst und dem Begriff des Politischen.
Wichtigste Veröffentlichungen: »Zum Abschied. Ein Essay zur Differenz« (transcript, 2001), »Marx zufolge. Die unmögliche Revolution« (transcript, 2004), »Mnema. Jacques Derrida zum Andenken« (Hg. gemeinsam mit Georg Christoph Tholen, transcript 2007), »Virtualität und Kontrolle« (Hg. gemeinsam mit Michaela Ott, Sarah Speck und Harald Strauß, material Verlag der HfbK Hamburg, 2008).






















